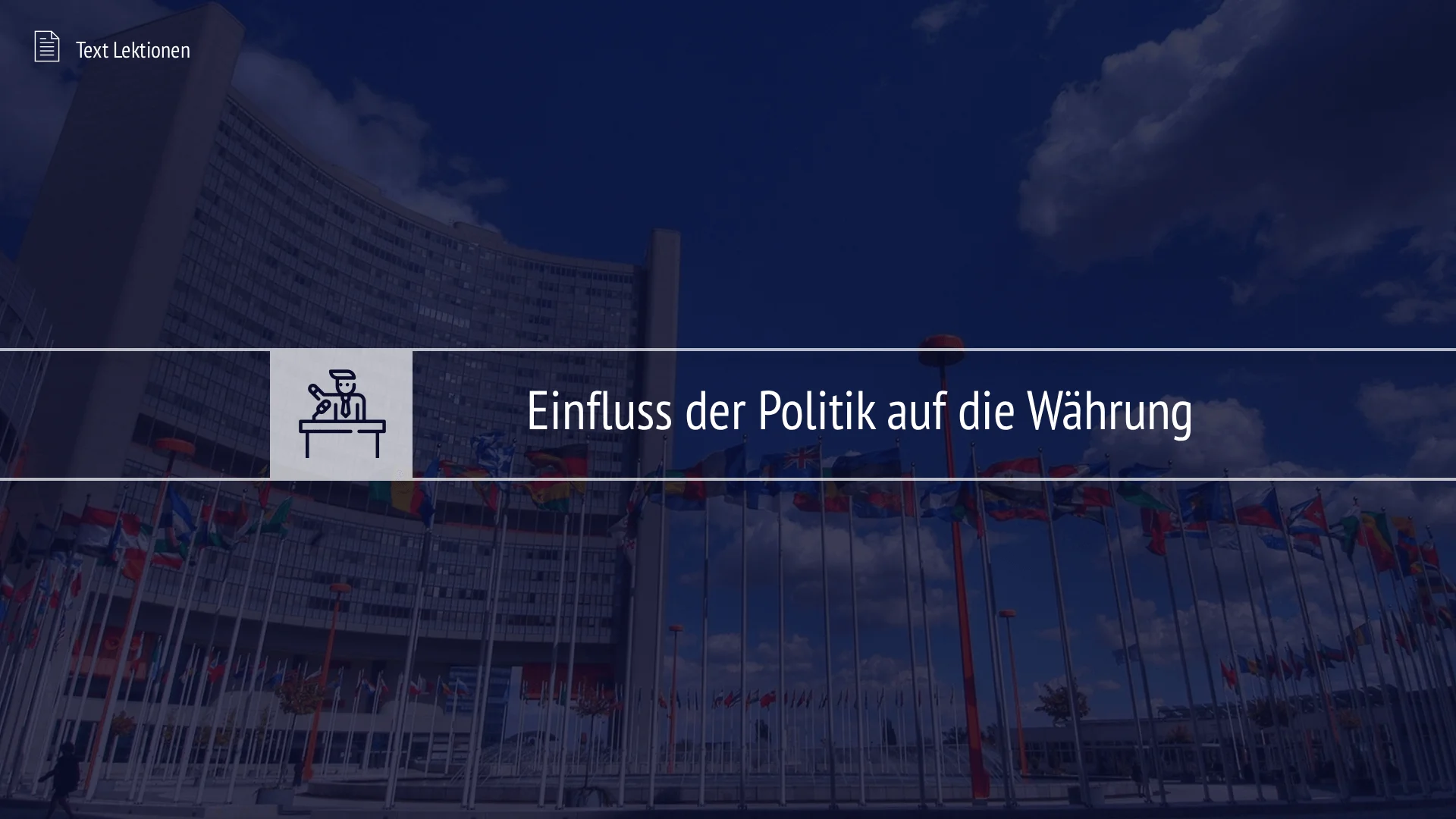In dieser Lektion lernst du, wie die Geldpolitik der Zentralbank und die Regierungspolitik über fiskalische und monetäre Maßnahmen die Währung beeinflussen.
Geldmenge – die gesamte Geldmenge in der Wirtschaft
Der Preis einer Währung wird – wie bei anderen Vermögenswerten – durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher beeinflusst die Geldmenge in der Wirtschaft den Preis der Währung. Die Geldmenge kann als die gesamte Menge an verfügbarem Geld in der Wirtschaft definiert werden. Wenn die Geldmenge steigt, nimmt die Menge an Kapital für Ausgaben und Investitionen zu, was die Wirtschaft stimuliert. Wenn die Geldmenge sinkt, tritt der gegenteilige Effekt ein.
Das Wachstum der Geldmenge muss kontrolliert werden. Eine zu hohe Geldmenge erhöht die Inflation auf ein Niveau, das der Wirtschaft schadet. Eine zu geringe Geldmenge kann hingegen das Wachstum bremsen. Entscheidungsträger müssen das richtige Gleichgewicht zwischen Inflation und Wachstum durch expansive oder restriktive Geldpolitik finden.
Expansive Geldpolitik bedeutet, dass die Zentralbank Wege sucht, die Geldmenge zu erhöhen, während restriktive Geldpolitik darauf abzielt, sie zu verringern.
Die zwei häufigsten Instrumente zur Steuerung der Geldmenge sind die Festlegung der Zinssätze und die Änderung der Mindestreserveanforderungen für Banken.
Zinsänderungen beeinflussen die Geldmenge
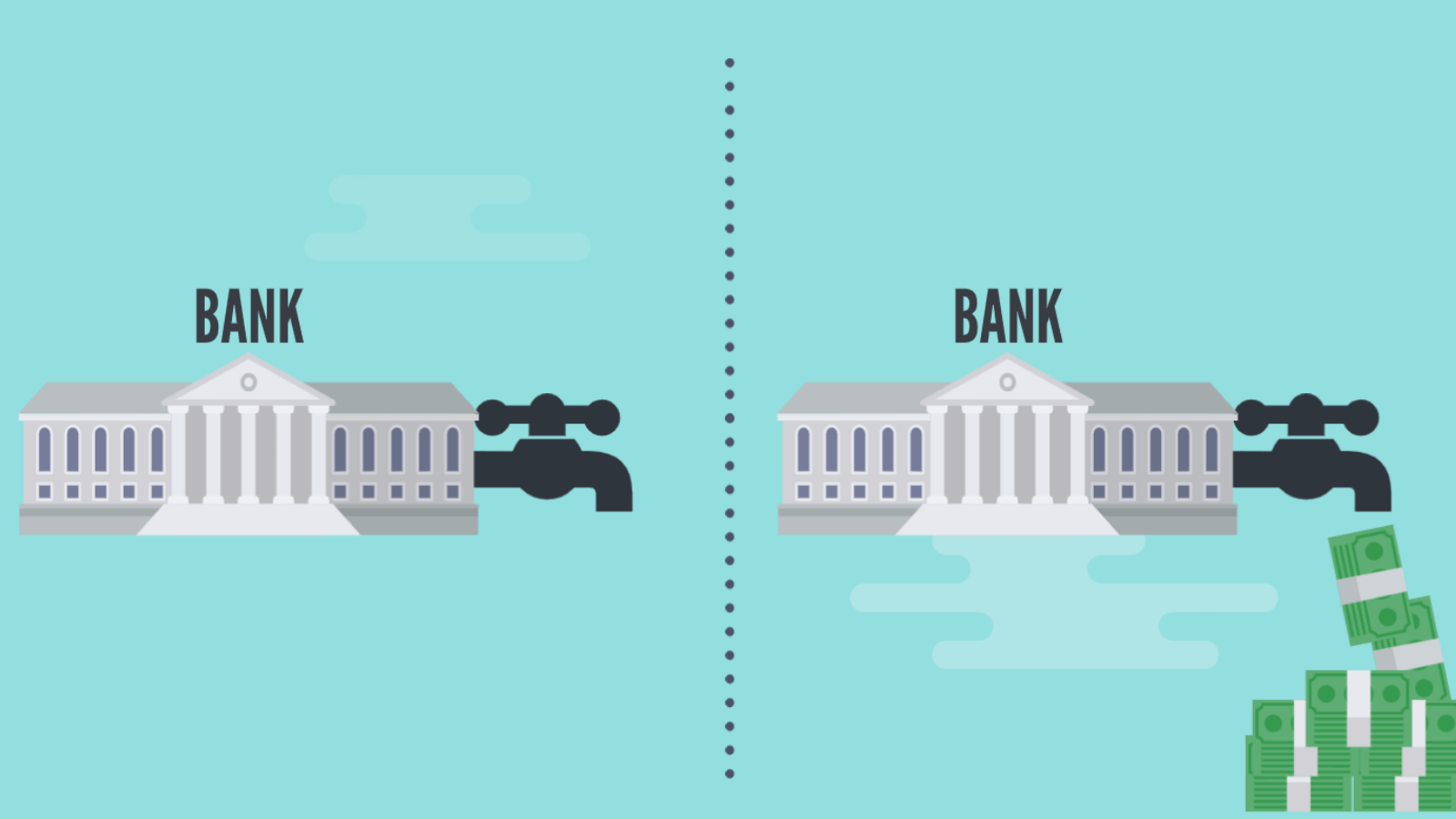
Um das Kapital in der Wirtschaft zu begrenzen, kann die Zentralbank die Zinssätze erhöhen. Dies schränkt effektiv die Anzahl der Kredite ein, die Kunden oder Unternehmen aufnehmen können, da höhere Zinsen höhere Kreditkosten bedeuten.
Weniger Kredite bedeuten weniger Investitionen und Konsum, wodurch die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen sinkt. Auf diese Weise kann auch die Inflation kontrolliert werden, da geringere Nachfrage tendenziell das Preiswachstum verlangsamt oder senkt.
Um die verfügbare Kapitalmenge in der Wirtschaft zu erhöhen, senkt die Zentralbank die Zinssätze. Dadurch werden Kredite günstiger, was die Wirtschaft durch höhere Ausgaben und Kreditaufnahme stimuliert.
Restriktive Politik hat positive Auswirkungen auf die Währung
Eine restriktive Politik wirkt sich positiv auf die Währung aus, da steigende Zinssätze neues Kapital in die Wirtschaft ziehen. Hohe Zinssätze gelten oft als Zeichen einer starken Wirtschaft. Außerdem verdienen Investoren mehr Gewinn auf Kapital, das sie in den Banken dieser Wirtschaft halten.
Expansive Geldpolitik wirkt sich negativ auf die Währung aus
Eine expansive Geldpolitik hat oft negative Auswirkungen auf die Währung, da sie Kapital leichter zugänglich macht, was zu inflationären Effekten führen kann. Die Kaufkraft der Währung sinkt und damit ihr Wert.
Niedrige Zinssätze bedeuten auch geringere Renditen für Investoren, was Kapitalabflüsse begünstigt und den Währungswert zusätzlich schwächt.
Kontrolle über Mindestreserven der Banken beeinflusst die Geldmenge
Eine weitere Methode zur Steuerung der Geldmenge besteht darin, zu begrenzen, wie viel Geld Banken an Unternehmen oder Privatpersonen verleihen dürfen. Dies geschieht durch die Festlegung einer Mindestreservepflicht.
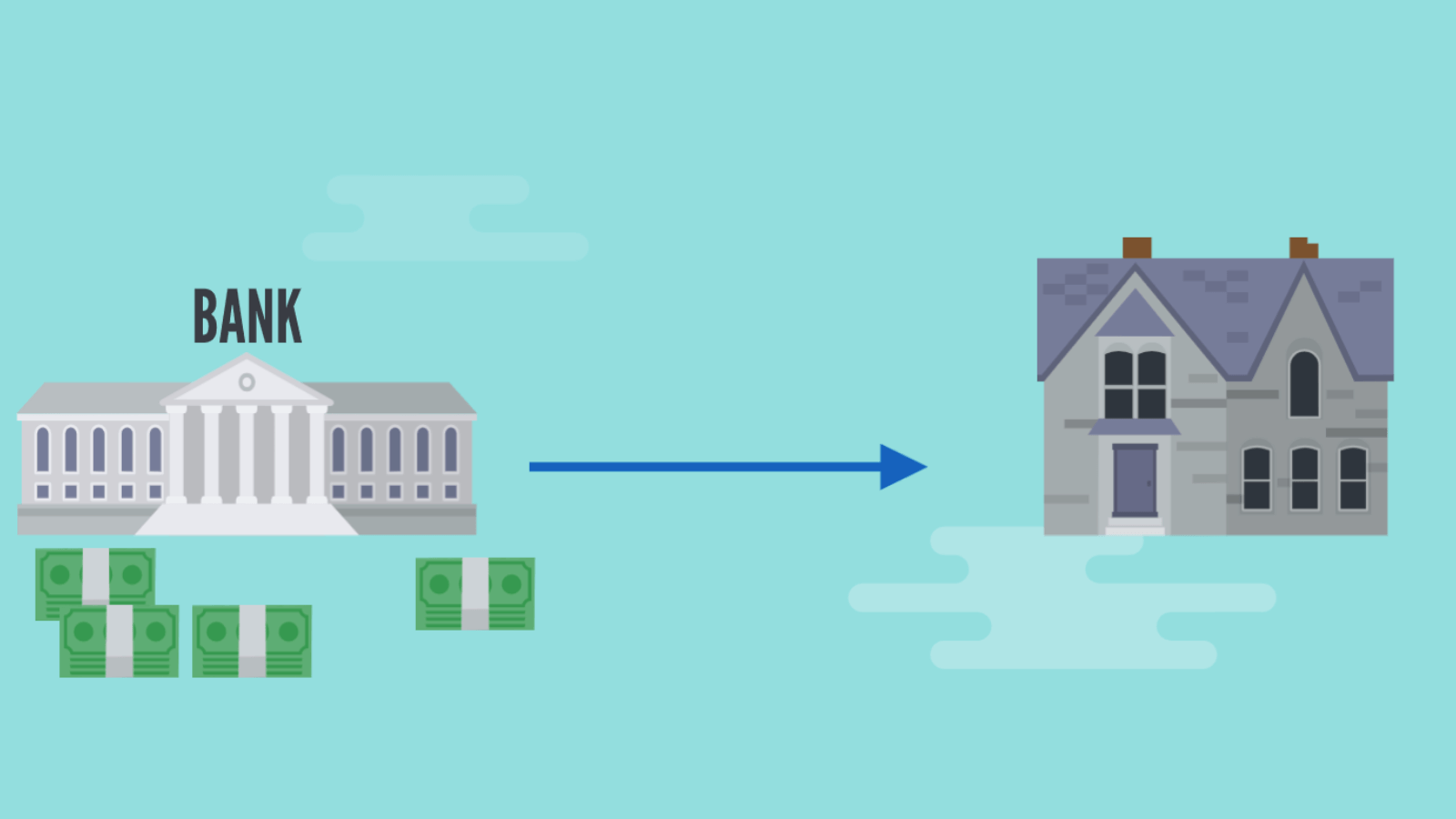
Banken halten einen kleinen Teil ihrer Vermögenswerte als Bargeld, das jederzeit abgehoben werden kann. Der größte Teil wird als Kredite oder Investitionen vergeben. Die Zentralbank legt fest, welcher Mindestbetrag als Reserve gehalten werden muss – die sogenannte Mindestreserve.
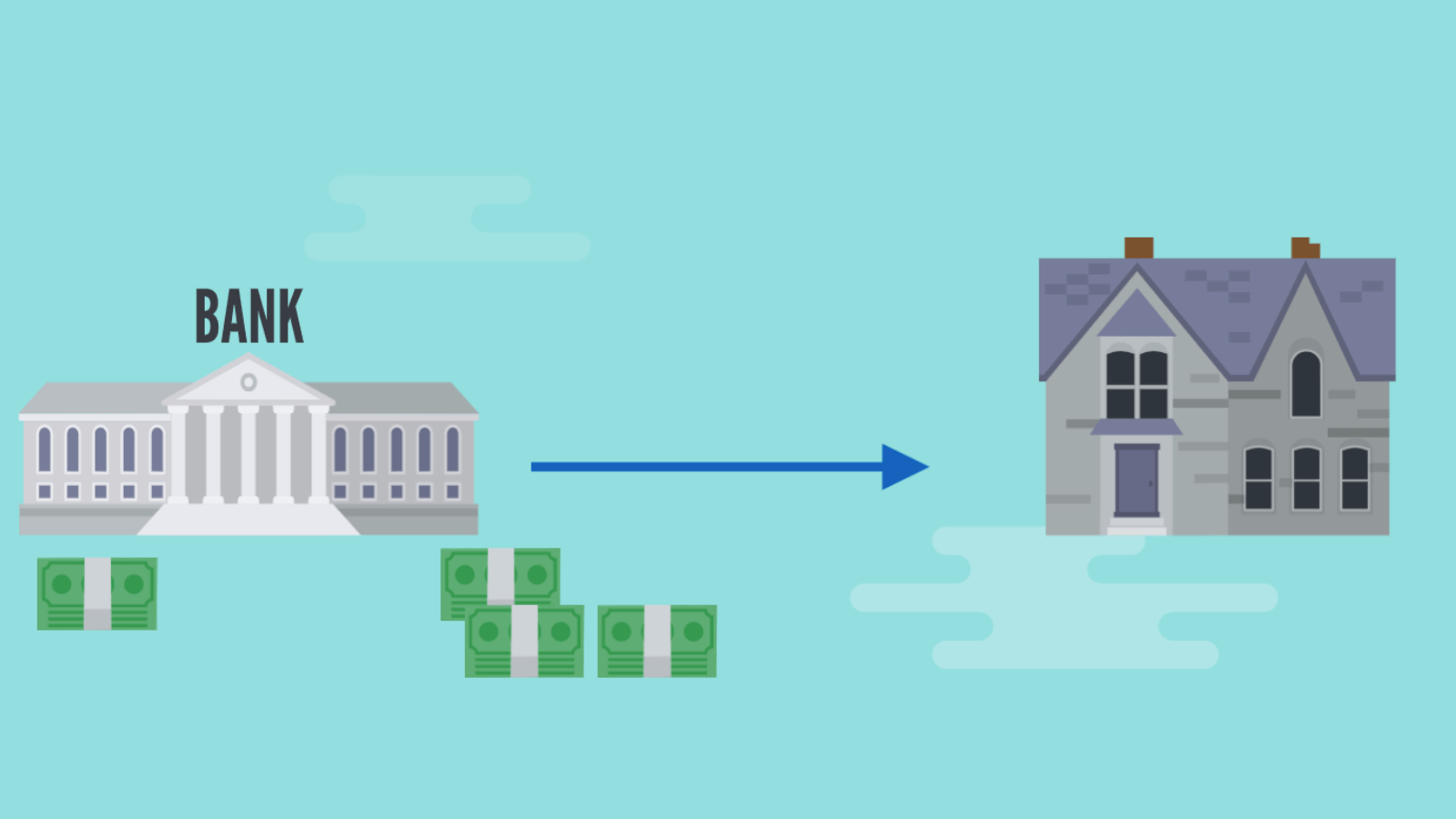
Wenn die Zentralbank die Mindestreserve erhöht, sinkt das Kapital, das Banken verleihen können, wodurch die Geldmenge und das Kapitalangebot in der Wirtschaft abnehmen.
Eine Senkung der Mindestreserve hat den gegenteiligen Effekt – Banken können mehr verleihen und investieren, wodurch die Geldmenge steigt.
Änderungen der Mindestreserve können den Währungspreis beeinflussen
Diese Änderungen wirken ähnlich wie Zinsänderungen durch die Zentralbank.
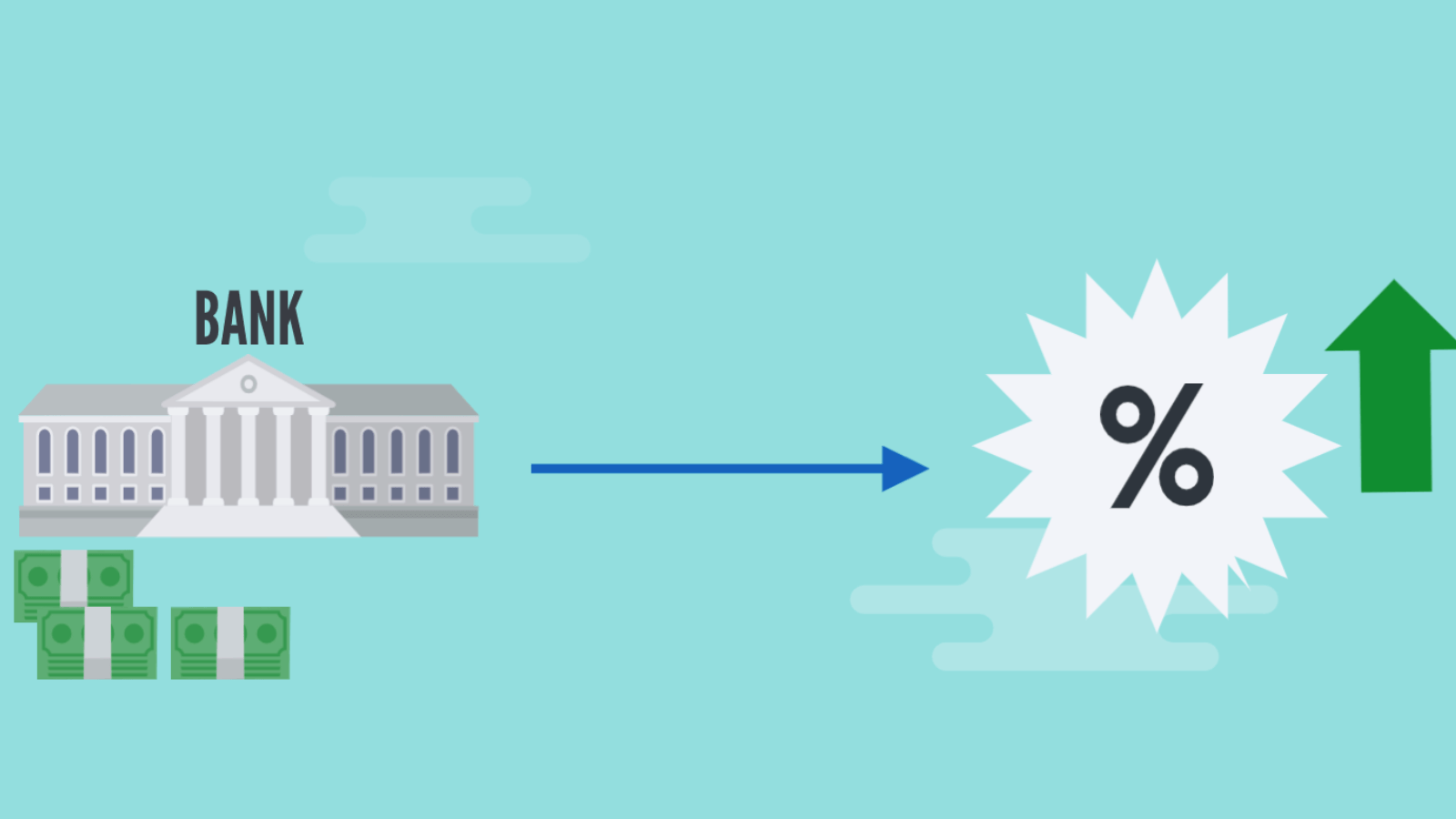
Wenn Banken höhere Reserven halten müssen, verringert sich die Menge des verleihbaren Geldes, wodurch die Zinssätze steigen. Für Sparer ist dies jedoch vorteilhaft, da sie höhere Renditen erzielen. Das kann zu einem Anstieg des Währungswertes führen, weil mehr Kapital ins Land fließt. Umgekehrt kann eine Senkung der Reserveanforderungen zu einer Abwertung führen, da mehr Kredite zu niedrigeren Zinsen vergeben werden.
Fiskalpolitik kann die Wirtschaft stimulieren
Die staatlichen Ausgaben bilden die Fiskalpolitik eines Landes. Entscheidungsträger nutzen sie, um die Wirtschaft durch Anpassung von Ausgaben und Steuern zu beeinflussen.
Die Mittel, die der Staat ausgibt, stammen aus Steuern oder aus der Kreditaufnahme über Staatsanleihen. Wenn die Regierung mehr ausgibt, als sie durch Steuern oder Anleihen einnimmt, entsteht ein Haushaltsdefizit.
Staatliche Ausgaben sind ein wichtiges Instrument zur Ankurbelung der Wirtschaft, etwa durch Infrastrukturprojekte oder die Einstellung von Beamten.
Solche Ausgabenprogramme wirken stimulierend, da sie Kapital in Umlauf bringen. Ein Beispiel wäre der soziale Wohnungsbau, der Bauunternehmen und Hersteller von Baustoffen zugutekommt.
Eine lockere Fiskalpolitik kann sich positiv auf Investitionen in die Währung auswirken, was tendenziell den Währungswert erhöht.